

Die Suche nach dem Urtier
Was sind die urtümlichsten aller lebenden Tiere? Lange Zeit hieß es: Schwämme. Doch es sind die Rippenquallen. Ein deutscher Biologe ahnte das schon früh – doch die Idee konnte sich lange nicht durchsetzen.
Schillernd. Rippenquallen schweben seit einer Milliarde Jahre durch die Weltmeere.
Zwei Millionen könnten es sein. Genau weiß niemand, wie viele Tierarten den Globus bevölkern. Generationen von Biologen haben versucht, die Vielfalt zu ordnen. Dafür ergründeten sie das Innere von Würmern, zählten geduldig die Haare auf den Beinen von Insekten oder verbrachten ein ganzes Forscherleben damit, die Formenvielfalt der Kopulationsorgane von Spinnen zu vergleichen. Sie entwarfen Dutzende Stammbäume, jeder zeichnete die Evolutionsgeschichte der Tiere anders, jeder hatte eine andere Theorie, wie das Urtier, der Urahn der vielzelligen Fauna, ausgesehen haben könnte.
Und da es keine objektive Messmethode gab, um die Evolution der Tiere zu rekonstruieren, verteidigte ein jeder seine Theorie nicht nur mit Argumenten, sondern auch mit Beleidigungen. Honorige Zoologen zankten wie Kinder im Sandkasten, die ihre eigene Burg für die schönste halten.
Das Gezeter verstummte erst, als in den 1980er Jahren die Technik der Erbgutanalyse erfunden wurde. Endlich konnte man die DNS der Arten miteinander vergleichen, ihren Verwandtschaftsgrad und ihr evolutionäres Alter messen. Nach und nach etablierten Molekularbiologen und Zoologen so eine neue Systematik des Tierreichs, die „Neue Stammesgeschichte der Tiere“. Erst vor Kurzem nahmen sich Genforscher das Erbgut der Rippenquallen vor – und wurden überrascht: Diese gallertigen, tagsüber in allen Regenbogenfarben schillernden und nachts sogar in grünlichem Licht gespenstisch glimmenden Kreaturen sind dem Urtier am ähnlichsten. Kaum ein Zoologe hätte das für möglich gehalten. Nur Wolfgang Friedrich Gutmann (1935 – 1997) vom Frankfurter Forschungsinstitut Senckenberg hatte diese kaum erforschten Tiere schon 1976 an die Basis tierischen Lebens gestellt.
Rippenquallen haben wenig gemein mit den Kreaturen, die Touristen schrecken
Rippenquallen haben außer einem ähnlich glibberigen Körperbau mit den bei Strandurlaubern so unbeliebten Nesselquallen nichts gemein. Sie haben keine Nesselzellen, mit denen sie Beute fangen oder Touristenhaut traktieren könnten. Eine der am besten untersuchten Arten ist die Meerwalnuss Mnemiopsis leidyi. Anders als die meisten Rippenquallen kommt die etwa zehn Zentimeter lange Qualle nicht in der Tiefsee, sondern in Küstennähe vor und lässt sich im Labor nachzüchten. Wohl nicht zuletzt deshalb entschloss sich Casey Dunn von der Brown-Universität auf Rhode Island, als erstes Rippenquallen-Erbgut das der Meerwalnuss zu analysieren und mit dem Erbgut von Schwämmen, Nesselquallen, Weichtieren und anderen ursprünglichen Tierarten zu vergleichen.
Dabei stellte er fest, dass die Vorfahren der heute noch lebenden Rippenquallen bereits existierten, bevor sich Schwämme und alle anderen Tiere entwickelten. Eine provokante These, als würde sich jemand hinstellen und anstelle von Schimpansen Giraffen als die nächsten Verwandten des Menschen bezeichnen.
Tatsächlich erscheinen die filigranen Rippenquallen auf den ersten Blick viel zu komplex, um die „primitivsten“ Tiere zu sein. Während die Quallen sowohl Muskelzellen als auch ein einfaches Nervensystem haben, haben Schwämme nur haut- und darmähnliche Gewebe. Es klang also logisch, dass erst Schwämme mit zwei Zelltypen existierten, aus denen dann die Rippenquallen mit vier Gewebearten hervorgingen. Oder haben die Schwämme Nerven- und Muskelzellen zurückgebildet, weil sie am Meeresboden dafür keine Verwendung hatten?
Lange galt die Ähnlichkeit als Hinweis auf eine Verwandtschaft – das barg Fehlerpotenzial
Bevor sich die Molekularbiologie durchsetzte, war es für Evolutionsforscher ein fast hoffnungsloses Unterfangen, solche Fragen zu beantworten. Als bestmöglicher Beleg für die Verwandtschaft zweier Arten oder Tiergruppen galt die Ähnlichkeit charakteristischer Organe. Weil Haare bei Mensch und Maus sich sowohl identisch entwickeln als auch gleich aufgebaut sind, werden sie als „homolog“ bezeichnet und die beiden Arten in einer Tiergruppe, den Säugetieren, zusammengefasst. Die Haare von Insekten hingegen sind anders aufgebaut und entwickeln sich aus anderen Körperteilen. Sie sind also „analog“ und taugen nicht als Merkmal für Verwandtschaft. „Wolfgang Gutmann war das viel zu simpel“, sagt der Biologe und Paläontologe Michael Gudo. Wie einst Gutmann war auch Gudo am Frankfurter Senckenberg-Museum tätig, bevor er die Auftragsforschungsfirma Morphisto gründete. Ähnlichkeit habe ihm nicht gereicht, um Verwandtschaftsbeziehungen zu belegen. Sein Grundgedanke: „Wenn die Evolution ein lebendes System umbaut, dann kann kein Zwischenstadium existieren, das mechanisch und energetisch nicht funktioniert.“ Selbst wenn sich also die Organe von zwei Arten ähneln, dann können sie trotzdem nicht verwandt sein, wenn die Zwischenformen nicht lebensfähig sind.
Seite 1 von 3
nächste Seite
- Die Suche nach dem Urtier
- Deftige Worte für die Forscherkollegen
- Gutmann igelte sich ein und soll sich von seinen Gegnern verfolgt gefühlt haben
Artikel auf einer Seite lesen











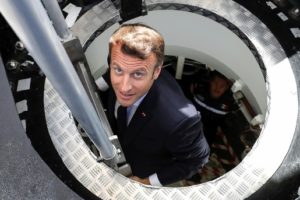








Comments